Konstrukteur: Max Oertz • Werft: Abeking & Rasmussen • Baujahr: 1923
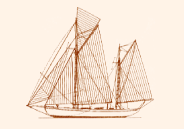
Buchprojekt
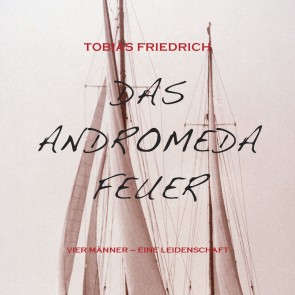 |
Das Andromeda-FeuerHardcover, 228 Seiten, davon 48 Bildseiten |
Auszug 1
Das Feuer auf der Kreuzeryacht Andromeda brach in den frühen Morgenstunden des 17.05.2001 aus. Die Gaffelketsch sollte am kommenden Tag zu einer Frühsommertour durch dänische Gewässer in See stechen, doch nachts nahmen mittschiffs gelb-rote Flammen das Schiff in Beschlag. Die Yacht lag zu der Zeit im Hafen von Rödby, auf der Insel Lolland, kaum zwanzig Kilometer von Fehmarn entfernt.
Dem Brand fielen der Salon, die Kombüse, das Kajütdach und am Ende die gesamte Elektrik des Schiffes zum Opfer. Der Mast wurde unter Deck und ein Meter über Deck zerstört. An Steuerbord verbrannte der Rumpf im Bereich des Salons, an verschiedenen Stellen die Decksplanken, sowie der Großbaum und die Gaffel.
In der dänischen Hafenstadt fand sich später niemand, der etwas gesehen oder gehört haben wollte. Es konnten weder Brandstifter ermittelt werden, noch ein triftiger anderer Grund für das Unglück. Das Einzige, was blieb, war ein verkohltes Wrack von siebzehn Meter Länge und knapp vier Meter Breite, dessen ehemalige Schönheit nicht viel mehr als eine Erinnerung war. Eine Erinnerung, die nur wenige Menschen in Rödby teilten, und schon bald wurde die Sache vergessen, und die Leute der Stadt gingen unter dem Kreischen der Möwen am Hafen wieder ihren üblichen Dingen nach.
Nach Wochen versuchten ein paar junge Dänen im Zuge eines Jugendprojektes zu retten, was nicht mehr zu retten war: Sie demontierten die Inneneinrichtung, wussten jedoch mit dem rußigen Kern der Yacht nicht viel anzufangen. Bereits kurze Zeit später wurde das Vorhaben gestoppt, die Andromeda blieb schwarz und leer an ihrem Platz liegen. Ein paar Monate gingen ins Land, und niemand beachtete mehr das träge im Hafenwasser wippende Schiff.
Nur ab und zu sah man in Rödby Hafenarbeiter mit ernsten Gesichtern die Anlegestellen passieren, und wenn sie an der Andromeda vorbeiliefen blieben sie stehen, schüttelten den Kopf und murmelten etwas wie:
„Ein Jammer, dass ein so tolles Schiff, so ein Ende findet.“
Auszug 2
Es ist der frühe Nachmittag des 18. August, als Jochen mit der Hündin auf der Andromeda von Ibiza Richtung Costa Brava segelt. Das Wetter ist dem Traum eines Reiseleiters entsprungen und die See scheint ebenso zu schlafen wie der junge deutsche Skipper. Wie üblich, hat er vor einer guten Stunde seiner Hündin das Deck überlassen. „Pass gut auf die Schiffe auf“, hatte er ihr gesagt, und wie sonst auch schoss Andy sofort an den Bug der Gaffelketsch und begann das Meer zu mustern. Jochen war lächelnd zum Cockpit gegangen und hält dort nun ein Nickerchen. Die Andromeda befindet sich gute hundert Seemeilen von jedem Land entfernt, das Leben könnte nicht angenehmer sein.
Er träumt einen gegenstandslosen Traum, der im Wesentlichen sein Leben widerspiegelt, eine sorglose Metapher des Glücks, das er durch sein Leben mit der Andromeda empfindet. Die Sonne erleuchtet das Cockpit. Die Flaute auf dem Wasser ist allumfassend, endgültig und beschlossen. Helles Orange sickert durch Jochens geschlossene Lider. Sein Vollbart kitzelt ab und zu etwas auf der Brust. Gerade wölbt sich ein großes Segel in seinem Traum, als er ein Geräusch vernimmt. Es bohrt kleine Löcher in seinen Schlaf. Es hört auf, und Jochen schluckt einmal kurz, leckt sich die Lippen und verschränkt die Arme neu vor der Brust. Da ist es wieder. Wuff wuff. Andy. Das leise Dampferbellen von Andy, welches übersetzt bedeutet: Schau mal, Jochen, ein Schiff, klein wie ein Stück Hundefutter, ganz hinten, am Ende des riesigen Wassernapfs. Wuff wuff. Wau wau. Jochens Traum ist zu Ende. Er räkelt sich kurz, steht auf und trottet zu der Hündin herüber.
„Das sollte jetzt besser ein Seeungeheuer sein, Andy. Ich hab gerade geträumt, ich sei bei strahlendem Sonnenschein allein auf einem Schiff im Mittelmeer“, scherzt er und tappt seiner Hundefreundin auf den Kopf.
Es ist nichts zu sehen. Das Meer ist das schattige Spiegelbild des Himmels. Glatt, blau und reglos. Poseidons Mittagspause.
Wuff wuff.
„Andy, was ist los? Brauchst du wen zum Reden?“
Wau wau wau.
Jochen kratzt sich den Bart. Es ist bei Gott weder ein Schiff, noch Treibholz oder einer der im Mittelmeer auftretenden Finn- oder Grindwale zu sehen. Er holt sein Fernglas und sucht die Richtung ab, in die Andy bellt. Im zweiten Anlauf entdeckt er etwas. Es ist ein Eimer. Kurz vor dem Horizont wippt tatsächlich ein dunkler Eimer im Wasser.
„Also, eine Brille brauchst du jedenfalls nicht“, murmelt Jochen. „Aber es ist bloß ein Holzbottich, meine Liebe. Der kann uns nichts anhaben.“
Andy wirft Jochen einen erwartungsvollen Blick zu. Und bellt.
„Was soll ich deiner Meinung nach machen, he? Unser Motor ist kaputt. Bis wir bei der Flaute da hin geschippert sind, ist Winter. Und ernsthaft, ich werde nicht Himmel und Hölle in Bewegung setzen, nur weil dir langweilig ist.“
Hundeblick.
Wau.
Jochen atmet lang und tief durch die Nase ein und wieder aus, nickt dann der Hündin langsam zu und setzt sich lächelnd in Bewegung.
„Ok. Du forderst mich heraus, also los.“
Er geht zu dem Benzinmotor und schraubt die vier Zündkerzen heraus. Die Andromeda hat noch Strom von den in Ibiza aufgeladenen Batterien. Jochen geht ins Cockpit und legt den Gang ein. Mit dem Anlasser gibt er so viel Druck wie möglich auf das Ruder und versucht das Schiff in die Richtung des Eimers abdrehen zu lassen. Die Segel sind zum Wenden nicht zu gebrauchen. Sie hängen schlaff in der Sonne wie unbenutzte Handtücher. Er hat Glück. Mit dem Schwung des Anlassers treibt die Andromeda ganz langsam in die gewünschte Ecke des Meeres.
Andy jault vor Freude und Aufregung, bellt immer wieder, als würde die Yacht einem aus dem Meer ragenden Knochen entgegen streben. Jochen schätzt die Entfernung zum Eimer auf drei- oder vierhundert Meter. Er stellt die Batterie nach dem Wendemanöver wieder ab und wartet, wie gut das Schiff in die entgegengesetzte Richtung seiner geplanten Route vorankommt.
„Ich will nach da“, ruft er Andy zu und zeigt mit dem Finger auf den Horizont hinter seinem Rücken. „Und wegen dir steuern wir jetzt dahin, wo wir herkommen. Aber gut...“ Jochen steht unter keinem Zeitdruck, und langsam interessiert ihn die Geschichte, auch wenn er das seiner Hündin gegenüber nur zögernd zugibt. „Schauen wir also mal, was für ein Fabrikat das ist. Es gibt ja solche und so’ne Eimer. Ich bin sehr gespannt.“
Andy wedelt mit dem Schwanz und bellt vor Freude, ihre Nase hüpft immer wieder in die gewünschte Richtung.
Jochen sieht lachend durch das Fernglas, um den Eimer nicht aus den Augen zu verlieren. Er lacht und lacht in der Vorstellung, mit Andy in den Kampf gegen einen feindlichen Eimer zu ziehen, als er durch das Okular eine Hand aus dem Wasser ragen sieht, die im selben Moment wieder verschwindet. Mit einem Ruck zieht er das Fernglas von seinen Augen und starrt den Bruchteil einer Sekunde Andy an. Dann setzt er das Fernglas erneut an, dreht an der Schärfentiefe herum. Nichts. Das Meer ist leer. Weder Eimer noch Hand zu sehen. Es ist, als wären sie nie da gewesen. Er sucht das Wasser ab. Keine Spur, doch dann, eine kleine
Bewegung. Da ist sie wieder. Es ist eine menschliche Hand. Der Eimer ist kein Eimer, es ist ein Kopf. Jochen kann nicht viel erkennen. Es muss ein Taucher sein, denkt er. Aber wie in Teufels Namen kommt hier ein Taucher her? Taucher fallen nicht vom Himmel. Er rennt ins Cockpit und holt einen Tampen. Andy bellt und bellt. In Windeseile bindet er sich den Tampen fest um den Bauch und belegt ihn mittschiffs auf einer Klampe. Danach legt sich der Deutsche mit dem Bauch auf das Deck, schiebt seinen Oberkörper unter der untersten Reling hindurch, die Hüfte an der Kippe zu Außenwand, den Tampen mit einer Faust fest umschlossen. Mit der bellenden Andromeda und einem ausgestreckten Arm kommt er dem ehemaligen Eimer immer näher.
Nach Jochens Einschätzung ist die junge Frau nicht älter als zwei- oder dreiundzwanzig Jahre.
Sie schwimmt im Wasser und sieht aus, als würde sie seit zwei Jahren so im Meer treiben. Ihre Haut hat einen ungemütlichen Teint, der, obwohl ursprünglich wohl dunkelbraun, jetzt weich und hellrosa schimmert und an Garnelen erinnert. Die Haare hängen kurz, aber wirr und in Strähnen in ihre Stirn. Die Wimpern ihrer Augen fließen über vor Wasser, das beständig gegen ihr Gesicht klatscht. Jochen macht sich so lang, wie er kann und streckt die Hand nach ihr aus. Noch ein paar Meter, dann hat er sie. Und dann geschieht etwas, das Jochen sein Leben lang nicht vergessen wird. Statt wild fuchtelnd, ertrinkend nach seinem Arm zu greifen, zu schreien oder panisch einfach unterzugehen, spricht die Frau. Sie sagt etwas. Es klingt mitgenommen und furchtbar schwach. Doch sie sagt es, als würde sie ihn in einem Café nach der Uhrzeit fragen.
„¿A dónde vas?“
Wo fährst du hin?
Jochen zuckt einen Moment zurück. Diese mitten in einem 2,5 Millionen Quadratkilometer großen Gewässer treibende Frau, fragt ihn nach seinem Ziel, als bestünde die Möglichkeit, er könne „Korsika“ sagen und sie daraufhin wie eine Anhalterin mit den Schultern zucken und entgegnen: „Schade, ich will nach Marokko, naja, andern Mal, schönen Tag noch.“
In der nächsten Sekunde ergreift er den Arm der jungen Frau, murmelt etwas wie „Egal“, zieht sie mit aller Kraft aus dem Wasser und hievt sie an Deck. In diesem Moment erlebt er die nächste Überraschung. Die Frau ist weder bei einem Tauchgang zurück gelassen worden, noch beim Schwimmen abhanden gekommen. In einem Kraftakt, der Jochen später unglaublich erscheinen wird, zieht er die Erwachsene in kompletter Montur aus dem Meer. Sie hat eine Bluse, Jeans und Schuhe an, sie trägt Schmuck und eine Uhr, als wäre sie vor einer halben Stunde noch an einer Promenade der Costa Brava entlang spaziert. Als sie an
Deck liegt, zeigt die Frau auf das Meer. Jochen dreht sich um und was er sieht, dreht ihm den Magen um.